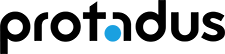Was ist ein Whistleblower?
Ein Whistleblower ist aus dem Englischen übersetzt eine Person, die in eine Trillerpfeife bläst. Im übertragenen Sinn sind damit Personen gemeint, die über unethisches Verhalten berichten oder Missstände aufdecken wollen, idealerweise bereits bevor negative Konsequenzen eintreten. Im deutschsprachigen Raum werden Whistleblower meist Hinweisgeber genannt.
Handlungsbedarf ab Juli 2023
Die rechtliche Grundlage für den Schutz von Whistleblowern ist eine EU-Richtlinie (EU 2019/1937) vom 23. Oktober 2019 zum „Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden“. Whistleblower sollen danach einen weitreichenden gesetzlichen Schutz vor Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen genießen. Das Ziel ist: Mehr Personen als bisher sollen zur Abgabe von Hinweisen ermutigt werden. Missstände sollen dadurch möglichst schnell aufgedeckt und beseitigt werden.
Die Richtlinie wurde durch das Hinweisgeberschutzgesetz in nationales Recht umgesetzt. Unternehmen ab 250 Beschäftigten müssen ab dem 2. Juli 2023 ein sicherer Hinweisgebersystem eingeführt haben. Für Firmen mit 50 bis 249 Beschäftigten gilt dies ab dem 17. Dezember 2023. Die Pflicht gilt auch für Städte und Kommunen. Das bedeutet: Hat eine Organisation 50 Beschäftigte oder mehr, ist das HinSchG ein Thema.
Zur Umsetzung der internen Meldestelle dürfen die Verpflichteten auch externe Dienstleister beauftragen. Als Ihr Dienstleister sorgen wir von PROTADUS dafür, dass Ihre Organisation alle gesetzlichen Anforderungen zum Hinweisgeberschutz erfüllt.
Whistleblowing ist wichtig
Whistleblower sind wichtig. Und es ist wichtig, diesen Personen einen geordneten und geschützten Rahmen zu geben. Denn wer Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten die Chance gibt, mögliche Verstöße gegen Gesetze oder (unternehmens-)interne Richtlinien zu melden, verbessert die Compliance des Unternehmens und kann damit Reputationsverluste verhindern. Für Städte und Kommunen gilt dies in gleicher Weise.
Darüber hinaus verbessert die Organisation ihre Attraktivität gegenüber Geschäftskunden, Partnern, Investoren, Banken und Mitarbeitern, erhöht die eigene Professionalität, fördert eine moderne, transparente und werteorientierte Unternehmenskultur und erhört die Bereitschaft, kritisches Wissen intern zu teilen. So ist es möglich, früh und aktiv Verstöße, Missstände oder regelwidriges Verhalten zu entdecken und dagegen vorzugehen.
UNTERNEHMEN UND KOMMUNEN IN DER PFLICHT
Unternehmen, Städte und Gemeinden mit mehr als 50 Beschäftigten sind verpflichtet, geeignete Verfahren einzurichten.
Städte und Gemeinden
Juristische Personen des öffentlichen Sektors sind schon seit dem 18. Dezember 2021 zur Errichtung einer internen Whistleblowing-Stelle nach Maßgaben der Whistleblowing-Richtlinie verpflichtet („Selbstbindung der Verwaltung“). Die EU-Richtlinien entfalten dann – wenn die Regelung so klar und eindeutig ist, dass sie keiner weiteren Konkretisierung durch eine nationale Gesetzgebung erfordert – eine unmittelbare Wirkung im Verhältnis zwischen Bürger und Staat.
Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern waren daher nach unserer Überzeugung schon ab Ende 2021 verpflichtet, geeignete interne Verfahren für die Entgegennahme von Meldungen und entsprechende Folgemaßnahmen einzurichten. Ab dem 2. Juli 2023 gibt es keinen Zweifel mehr: Die Pflichten des HinSchG gelten auch für öffentlich-rechtliche Beschäftigungsgeber.
Unternehmen und Kommunen
Die Investition in ein internes Meldesystem ist nicht nur eine Pflicht, sie zahlt sich für jede Organisation auf vielen Ebenen aus. Dies gilt für Unternehmen ebenso wie für Gemeinden. Wenn ein Hinweisgeber Anhaltspunkte dafür hat, dass Mitarbeitende einer Stadt nicht im Interesse der Stadt gehandelt haben (sich bestechen lassen, öffentliche Gelder verschwenden, ihre berufliche Position zum persönlichen Vorteil missbrauchen oder vielleicht sogar strafbare Handlungen begehen), hilft er der Stadt mit seiner Meldung.
Anforderungen an die interne Meldestelle
Das oberste Gebot lautet: Die interne Meldestelle muss die Vertraulichkeit der Identität
- der hinweisgebenden Person
- der Personen, die Gegenstand einer Meldung sind und
- der sonstigen in der Meldung genannten Personen
wahren. Hinweisgeber müssen die Möglichkeit haben, ihre Hinweise schriftlich (online/postalisch) oder telefonisch (Hotline/Mailbox) vertraulich und unter Wahrung der DSGVO-Vorgaben abzugeben. Für die weitere Verarbeitung der Hinweise sind konkrete Verfahrensschritte vorgesehen. Auch muss der Eingang eines Hinweises in kurzer Frist bestätigt werden.
Spannend ist: Das Hinweisgeberschutzgesetz sieht vor, dass auch anonym eingehende Meldungen bearbeiten werden sollen. Dieser Punkt war lange Zeit unklar. Wir sind überzeugt: Hinweisgebermeldesystem sollten schon jetzt eine anonyme Meldung und eine für die hinweisgebende Person anonyme Kommunikation zwischen ihr und der internen Meldestelle ermöglichen. Es gibt keinen Grund, diesen „Erkenntniskanal“ zur Meldung möglicher Rechtsverstöße in der Organisation nicht zu öffnen.
Die Meldung möglicher Verstöße erfolgt über ein Hinweisgebersystem. Dieses wird in Unternehmen und Verwaltungen eingesetzt, um Hinweisgebern einen vertraulichen Kommunikationskanal zu eröffnen, der auch anonyme Meldungen ermöglicht. Die effektivste Umsetzungsvariante ist eine Onlineplattform als Meldekanal.
Die Einrichtung und der Betrieb einer Meldestelle, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht, ist zeitaufwändig, erfordert spezifisches Fachwissen und bindet Ressourcen. Es ist keine Aufgabe, die sich „nebenher“ erledigen lässt.
Checkliste herunterladen
Testen Sie mit unserer Checkliste in wenigen Minuten selbst, ob die von Ihnen ausgewählte Lösung die durch das Hinweisgeberschutzgesetz vorgegebenen Aspekte erfüllt.
Mit Klick auf das PDF-Icon können Sie die Checkliste in einem neuen Fenster/Tab öffnen oder mit Rechtsklick herunterladen.
Extern ist besser
Sowohl Richtlinie und Gesetzesentwurf sprechen davon, dass eine „interne Meldestelle“ die Hinweise entgegennimmt. Allerdings kann die technische Umsetzung und das Case-Management auch von einer zuverlässigen externen Stelle übernommen werden, was entscheidende Vorteile bietet:
Whistleblowing konkret
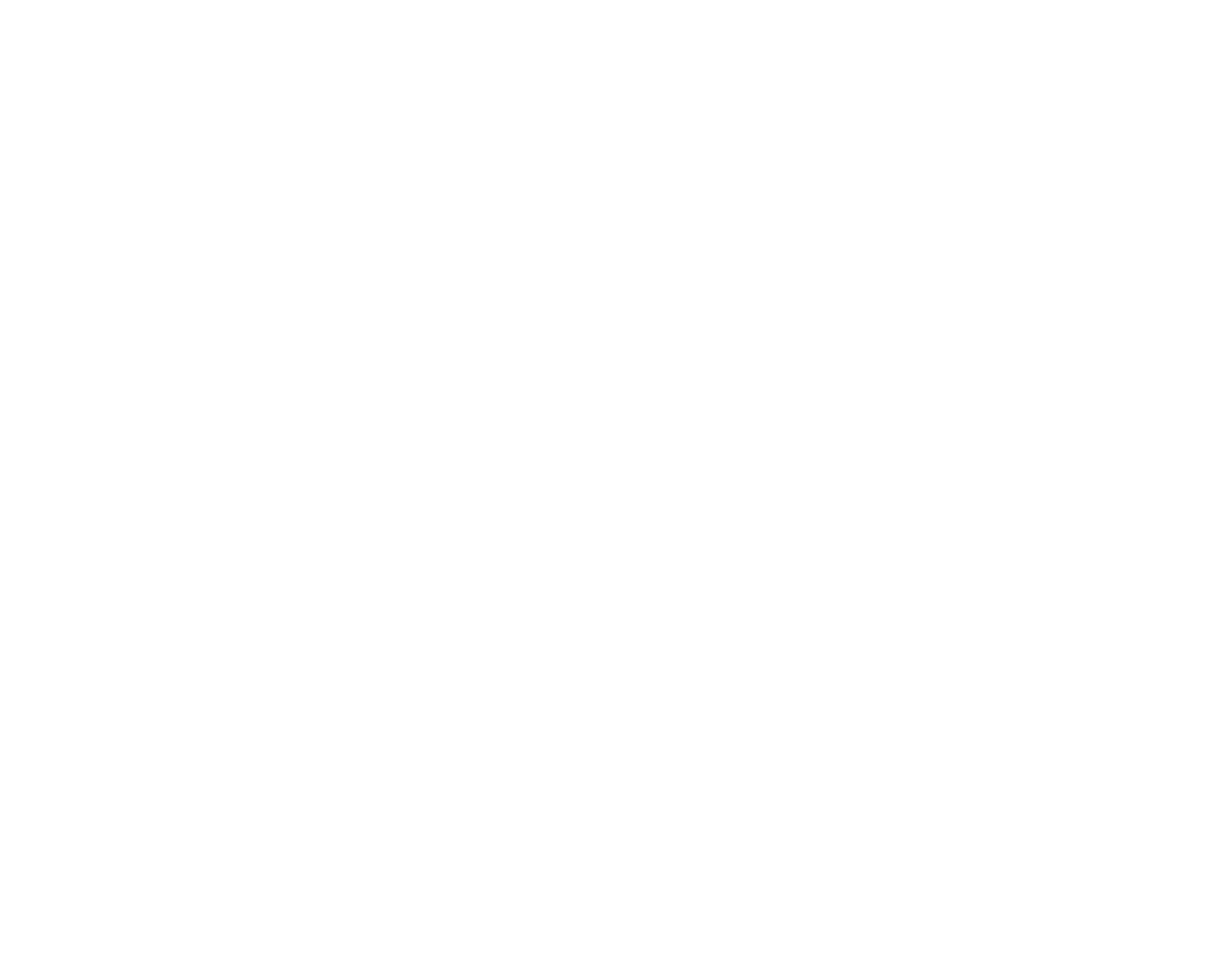
Whistleblowing konkret
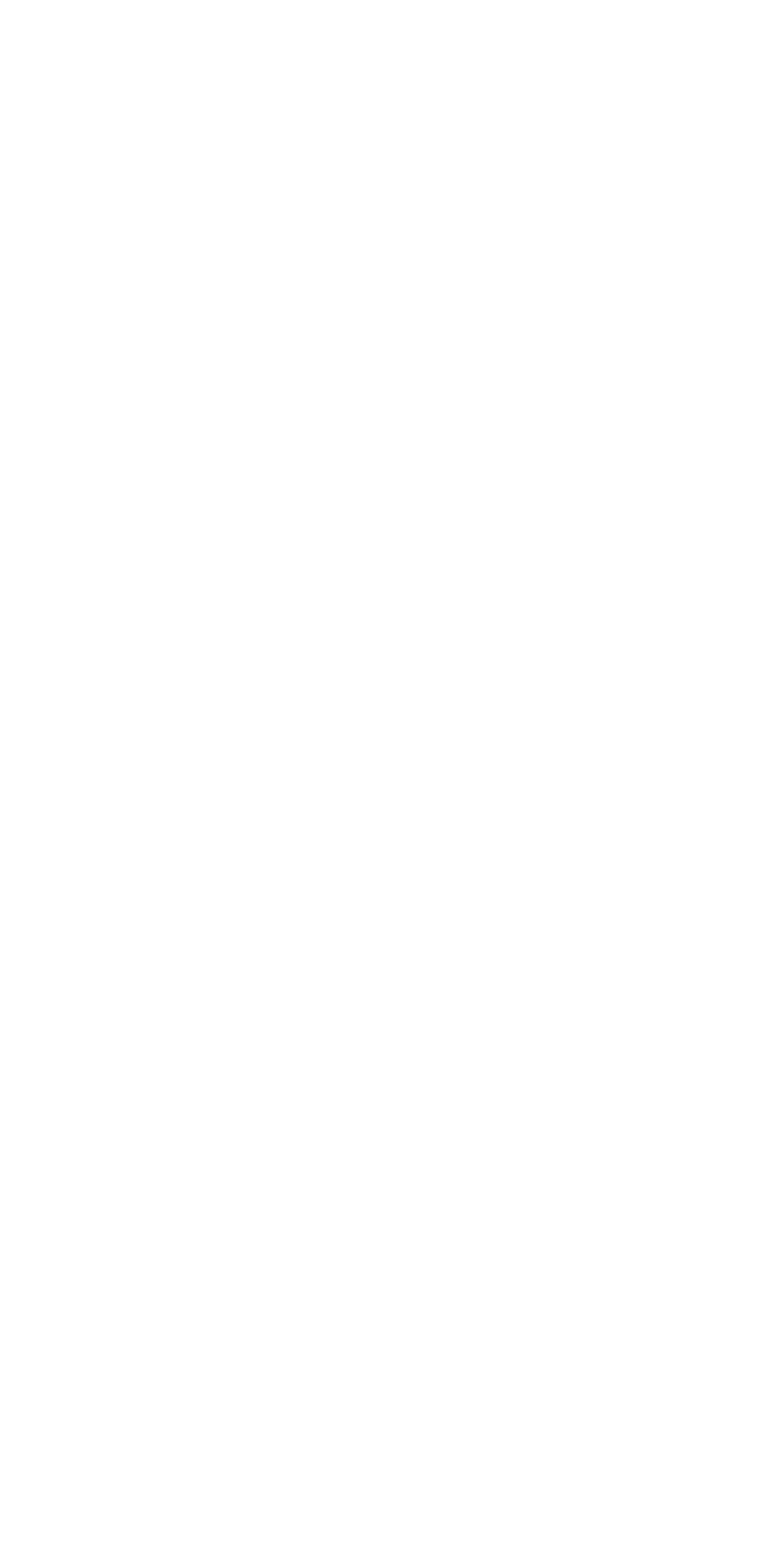
Die Lösung von PROTADUS
PROTADUS bietet ein technisch zuverlässiges Meldesystem, über welches Hinweisgeber vertraulich und anonym Hinweise geben können, online und telefonisch. Es ist konform mit der EU-Whistleblowing-Richtlinie, der DSGVO sowie dem nationalen Hinweisgeberschutzgesetz. Das PROTADUS-Meldesystem ermöglicht auch Rückfragen an den Hinweisgebenden, sogar wenn dieser seinen Hinweis anonym abgegeben hat.
PROTADUS stellt Ihnen nicht nur einen digitalen Briefkasten zur Verfügung, sondern übernimmt auch das fristgerechte, gesetzeskonforme Case-Management, entsprechend den mit Ihnen individuell abgestimmten Vorgaben. Zentrale Säule des Hinweisgebersystems ist das Prinzip eines fairen Verfahrens. PROTADUS garantiert den größtmöglichen Schutz für Hinweisgebende, Betroffene und die bei der Aufklärung des Hinweises beteiligten Mitarbeiter*innen. Für Betroffene gilt die Unschuldsvermutung, bis der Verstoß nachgewiesen ist. Die Ermittlungen erfolgen unter Einhaltung höchster Vertraulichkeit. Hinweise zu offensichtlich nicht Compliance-relevanten Themen beantwortet PROTADUS ganz ohne Ihre Mitwirkung.
Und wenn Hinweise eine rechtliche Aufarbeitung erfordern, übergeben wir den Fall an Sie als unseren Auftraggeber oder direkt an spezialisierte Anwälte, mit denen Sie zusammenarbeiten.
Noch nicht überzeugt?
Martin Duncker, Geschäftsführer von Protadus, beantwortet eine Frage, die ihm oft gestellt wird:
„Kann ich den Hinweisgeberschutzkanal nicht auch intern in meinem Unternehmen umsetzen?“
In unserem neuen Flyer erhalten Sie alle Antworten und viele weitere Informationen, warum es jetzt an der Zeit ist zu handeln. Mit Klick auf das PDF-Icon können Sie ihn in einem neuen Fenster/Tab öffnen oder mit Rechtsklick herunterladen.